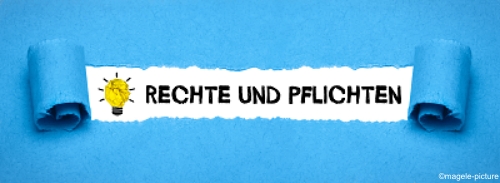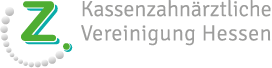Hat ein Patient Anspruch auf Herausgabe seiner Patientenakte?
Ja. Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) haben Patientinnen und Patienten Anspruch auf eine kostenfreie erste Kopie ihrer Behandlungsakte.
Sein Urteil vom 26.10.2023 stützt der Europäische Gerichtshof (EuGH) auf die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO): In Art. 15 Abs. 1 DSGVO (Auskunftsrecht) sei das Recht der Patienten verankert, eine erste Kopie ihrer Behandlungsakte zu erhalten, und zwar grundsätzlich ohne dass ihnen hierdurch Kosten entstehen. Ein solches Entgelt kann nur dann verlangt werden, wenn der Patient bzw. die Patientin eine erste Kopie seiner Daten bereits unentgeltlich erhalten hat und erneut einen Antrag auf diese stellt. Patienten müssen ihren Antrag auf eine Kopie ihrer Krankenakte zudem nicht begründen.
Zudem haben Patienten das Recht, eine vollständige Kopie der Dokumente zu erhalten, die sich in ihrer Patientenakte befinden, wenn dies zum Verständnis der in diesen Dokumenten enthaltenen personenbezogenen Daten erforderlich ist. Dazu gehören Daten, die Informationen wie Diagnosen, Untersuchungsergebnisse, Befunde der behandelnden Ärzte und Angaben zu Behandlungen oder Eingriffen enthalten.
Zahnärztinnen und Zahnärzte Auskunftsansprüche ihrer Patienten unverzüglich, in jedem Fall innerhalb eines Monats erfüllen, indem sie eine erste Kopie der gesamten Behandlungsunterlagen kostenlos zur Verfügung stellen.
Zu beachten ist, dass bereits das Verlangen eines Vorschusses auf die Kopie- und Versandkosten als Verzögerung bzw. Verweigerung des Auskunftsanspruchs und somit als Datenschutzverstoß gewertet werden kann.
|
Hat ein Patient Anspruch auf Einsichtnahme in die ihn betreffenden Röntgenbilder?
Ja, dieses Einsichtsrecht besteht.
Häufiger ist der Fall, dass ein nachbehandelnder Zahnarzt Einsicht in die Röntgenbilder wünscht, um die Anfertigung von möglicherweise überflüssigen weiteren Röntgenbildern zu verhindern oder die begonnene Behandlung angemessen fortsetzen zu können. Das Strahlenschutzgesetz sieht deshalb vor, dass der die Bilder anfertigende Zahnarzt die Original-Röntgenbilder dem nachbehandelnden Zahnarzt leihweise überlassen muss (§ 85 Abs. 3 Nr. 3 Strahlenschutzgesetz). Erfolgt die Überlassung der Röntgenbilder direkt zwischen dem vorherigen und dem neuen Behandler und liegen die Röntgenbilder digital vor, bietet das Online-Postfach der KZV Hessen eine Möglichkeit der sicheren und verschlüsselten Weitergabe.
Erfolgt die Weitergabe der Röntgenbilder nicht direkt zwischen dem vorherigen und dem neuen Behandler oder möchte der Patient vor der Weitergabe selbst Einsicht nehmen, so ergeben sich zwei Möglichkeiten:
1. Analoge Röntgenbilder
Der Behandler händigt dem Patienten die Original-Röntgenbilder vorübergehend zur Weitergabe an den nachbehandelnden Zahnarzt aus.
Hinweis für Zahnärzte: Der Empfang der Röntgenbilder sollte durch den Patienten schriftlich bestätigt werden. Dafür kann beispielsweise ein praxisindividueller Vordruck verwendet werden.
2. Digitale Röntgenbilder
Der Patient erhält seine Röntgenbilder gegen Kostenerstattung digital auf einem dafür geeigneten Träger. Vom Patienten mitgebrachte Datenträger dürfen grundsätzlich aus Sicherheitsgründen nicht an das Praxisverwaltungssystem angeschlossen werden.
|
Wann übernehmen die Krankenkassen die Kosten für eine Wurzelkanalbehandlung?
Eine Wurzelkanalbehandlung ist grundsätzlich eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV). Die Kosten werden übernommen, wenn der Zahn als erhaltungswürdig eingestuft wird. Die Richtlinie für die zahnärztliche Behandlung bestimmt, dass die Wurzelkanäle bis bzw. bis nahe an die Wurzelspitze aufbereitet und gefüllt werden müssen. Bei den hinteren Seitenzähnen (Molaren) ist eine Wurzelkanalbehandlung eine Leistung der GKV, wenn
• damit eine geschlossene Zahnreihe erhalten werden kann
• eine einseitige Freiendsituation vermieden wird
• der Erhalt von funktionstüchtigem Zahnersatz möglich wird
Ist die Wurzelkanalbehandlung eine Leistung der GKV, können zusätzliche private Leistungen in Anspruch genommen werden. Das sind die elektrometrische Längenbestimmung eines Wurzelkanals und die elektrophysikalisch-chemischen Methoden für die Reinigung und Desinfektion der Kanäle.
Diese Leistungen werden nach der privaten Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) nach den Gebührennummern 2400 „Elektrometrische Längenbestimmung eines Wurzelkanals“ und 2420 „Zusätzliche Anwendung elektrophysikalisch-chemischer Methoden, je Kanal“ dem Patienten privat in Rechnung gestellt.
|
Ist die professionelle Zahnreinigung eine Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung?
Nein. Als Patient einer gesetzlichen Krankenkasse haben Sie einmal im Kalenderjahr Anspruch auf eine Entfernung harter Zahnbeläge. Es handelt sich um Zahnbeläge, die sich durch Einlagerung von Mineralien aus Speichel und Nahrung „versteinert“ haben. Bei Patienten, die einen Pflegegrad aufweisen oder Eingliederungshilfe erhalten, ist die Entfernung harter Zahnbeläge zweimal im Jahr zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung möglich. Die PZR geht über das Entfernen der harten Zahnbeläge hinaus. Die Leistung umfasst das Entfernen der Beläge auf Zahn- und Wurzeloberflächen einschließlich der Reinigung der Zahnzwischenräume, die Entfernung des Biofilms („Plaque“), die Oberflächenpolitur zur Reduzierung der Wiederbesiedlung mit Belägen und geeignete Fluoridierungsmaßnahmen. Diese Maßnahmen werden auf Grundlage der Vereinbarung einer Privatbehandlung erbracht. Viele gesetzliche Krankenkassen gewähren ihren Versicherten allerdings einen Zuschuss zur PZR. Ob und in welcher Form sich Ihre Krankenkasse an den privaten Kosten beteiligt, können Sie bei Ihrer Krankenkasse erfragen.
Wenn eine PZR vereinbart und durchgeführt wurde, darf die Entfernung harter Zahnbeläge nicht als Leistung der GKV abgerechnet werden. Die PZR umfasst gemäß der Leistungsbeschreibung der GOZ bereits die Entfernung harter Zahnbeläge.
|
Für welche Füllungen übernimmt die Krankenkasse die Kosten?
Im Frontzahnbereich übernehmen Krankenkassen die Kosten für zahnfarbene Kompositfüllungen. Zu den Frontzähnen zählen die Schneide- und Eckzähne des Ober- und Unterkiefers.
Seit 1. Januar 2025 ist im Seitenzahnbereich die Versorgung mit plastischen Füllungsmaterialien, die ausreichend, zweckmäßig, erprobt und praxisüblich sind, ohne Zuzahlung der Versicherten als Kassenleistung vorgesehen.
GKV-Versicherte haben die Möglichkeit, statt einfacher plastischer Füllungen eine aufwendigere Versorgung zu wählen. In diesem Fall schließt der Zahnarzt mit dem Versicherten eine sogenannte Mehrkostenvereinbarung ab. Darin erklärt sich der Versicherte durch seine Unterschrift bereit, die Kosten für den bei der Behandlung anfallenden Mehraufwand selbst zu tragen. |
Wer zahlt die Kosten einer systematischen Behandlung von Parodontitis und anderer Parodontalerkrankungen?
Eine systematische Behandlung von Parodontitis und anderer Parodontalerkrankungen muss durch Ihre Zahnärztin bzw. Ihren Zahnarzt bei der gesetzlichen Krankenkasse beantragt werden. Dazu muss im Vorfeld der Befund erhoben und ein Parodontalstatus erstellt werden.
Nach der Genehmigung durch die Krankenkasse kann die Behandlung beginnen. Die Behandlung erstreckt sich aufgrund der neuen Richtlinie zur Parodontitisbehandlung vom 01.07.2021 über zwei Jahre. Sie umfasst das Aufklärungsgespräch, die Mundhygieneunterweisung, die antiinfektiöse Therapie und im Anschluss die Unterstützende Parodontitistherapie.
Die Unterstützende Parodontitistherapie beinhaltet die Mundhygienekontrolle, die Mundhygieneunterweisung (soweit erforderlich) und ggf. die Nachbehandlung einzelner Zähne sowie weitere Zwischenbefunderhebungen. Je nach Schweregrad der Erkrankung erfolgen diese Maßnahmen im viermonatigen, halbjährlichen oder jährlichen Abstand über zwei Behandlungsjahre.
Ziel dieser Maßnahmen ist es, die entzündlichen Veränderungen des Zahnhalteapparates zum Abklingen zu bringen und einem weiteren Rückgang von Zahnfleisch, Knochen und dem damit verbundenen Zahnverlust vorzubeugen sowie den Behandlungserfolg langfristig zu sichern. Dazu bedarf es einer guten Zusammenarbeit zwischen Zahnarztpraxis und Ihnen, auch was die Einhaltung der vereinbarten Termine betrifft.
Bei entsprechenden Krankheitsbildern können ggf. auch zusätzliche Leistungen notwendig werden, die nicht von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden und vor Behandlungsbeginn mit den Versicherten der GKV vereinbart werden müssen. Dabei ist die Schriftform zu bevorzugen.
Zusätzliche Leistungen können ggf. sein: - Lasertherapie
- Einsatz von Knochenersatz- und aufbaumaterialien
- Keim(zahl)bestimmung
- Einbringen von lokalen Antibiotika
o. Ä. |
Wann kann dem gesetzlich versicherten Patienten ein Heil- und Kostenplan (HKP) privat in Rechnung gestellt werden?
Nach Feststellung des zahnmedizinischen Befundes und der Diagnosestellung zur prothetischen Versorgung sowie einem Aufklärungsgespräch hat der gesetzlich Versicherte Anspruch auf die kostenfreie Ausstellung eines (1) HKPs mit der besprochenen Therapieplanung. Weitere HKP, beispielsweise für denkbare Alternativversorgungen, können mit dem Versicherten vereinbart und nach Maßgabe der GOZ privat berechnet werden.
Für außervertragliche Leistungen, z. B. im Rahmen einer Implantatversorgung oder einer Funktionsanalyse, die nicht im Rahmen einer vertragszahnärztlichen Versorgung erbracht werden können, kann ein HKP nach Gebührennummer 0030 GOZ „Aufstellung eines schriftlichen Heil- und Kostenplans nach Befundaufnahme und gegebenenfalls Auswertung von Modellen“ privat berechnet werden.
Eine Anlage zum gesetzlichen Heil- und Kostenplan mit der Aufstellung von privaten Leistungen rechtfertigt nicht die Berechnung der Gebührennummer 0030 GOZ. |
Wie und wann wird ein Mängelgutachten bei Patienten der gesetzlichen Krankenversicherung durchgeführt?
Führt der Zahnersatz innerhalb der Gewähr von zwei Jahren zu Beschwerden, ist zunächst der Zahnarzt aufzusuchen. Erst wenn der Zahnarzt auch nach mehrmaligen Versuchen keine Abhilfe schaffen kann, kann der Patient Kontakt mit seiner Krankenkasse aufnehmen. Diese kann eine nachträgliche, objektive Begutachtung veranlassen, um festzustellen, ob die durchgeführte Behandlung dem genehmigten Heil- und Kostenplan entspricht und ob die Zahnersatzversorgung Mängel aufweist. Falls Mängel festgestellt werden, dient das Gutachten als Grundlage für Ansprüche auf Mängelbeseitigung durch Nachbesserung oder Neuanfertigung. Der Patient erhält mit der Begutachtung Informationen hinsichtlich der Mängelfreiheit des Zahnersatzes oder zu Art und Umfang der Mängel und den Möglichkeiten der Mängelbeseitigung. |
Wann wird ein Privatgutachten durchgeführt?
Bei einem vermuteten Behandlungsfehler können Privatpatienten eine Begutachtung durch einen unabhängigen Sachverständigen bei der Landeszahnärztekammer Hessen beauftragen. Die Kosten sind vom Auftraggeber, dem Patienten, zu tragen.
Soweit gesetzlich Versicherte bereit sind, ein solches Gutachten auf eigene Kosten und ohne Einschaltung der Krankenkasse zu beauftragen, steht auch ihnen diese Möglichkeit offen. |
Haben gesetzlich Versicherte bei nicht abgeschlossener Zahnersatz-Behandlung Ansprüche gegenüber der Krankenkasse?
Ja. Wenn eine prothetische Behandlung aus berechtigten Gründen, beispielsweise durch zulässige Kündigung des Behandlungsvertrags, nicht abgeschlossen werden konnte, haben gesetzlich Versicherte einen Anspruch gegen ihre Krankenkasse auf anteilige Kostenübernahme. Je nachdem, wie weit die Behandlung bereits durchgeführt wurde, beläuft sich der Anspruch auf 0 %, 50 % oder 75 % der für die vorliegenden Befunde maßgeblichen Festzuschüsse. Der Festzuschuss wird somit anteilig gewährt.
Nach einem Abbruch der Behandlung kann der Zahnarzt bis dahin erbrachte zahnärztliche und zahntechnische Leistungen sowie die Materialkosten abrechnen. Möglich ist diese anteilige Abrechnung sowohl für vertragszahnärztlich erbrachte Leistungen (BEMA) als auch für privatzahnärztlich erbrachte Leistungen (GOZ/GOÄ).
|
Wann ist eine zahnärztliche Rechnung verjährt?
Zahnärzte können ihr Honorar für privatzahnärztliche Leistungen, die von dem Patienten selbst zu zahlen sind, nicht zeitlich unbeschränkt einfordern. Zahnärztliche Rechnungen unterliegen der Verjährung. Die Verjährungsfrist beträgt drei Jahre und beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Bei privatzahnärztlichen Rechnungen ist die Zustellung der Rechnung an den Patienten als anspruchsauslösendes Ereignis anzusehen.
Beispiel: Eine Rechnung mit Datum vom 20.06.2019 wird dem Patienten am 24.06.2019 zugestellt, weshalb die Verjährungsfrist mit Ablauf des 31.12.2019 beginnt und am 31.12.2022 endet. |